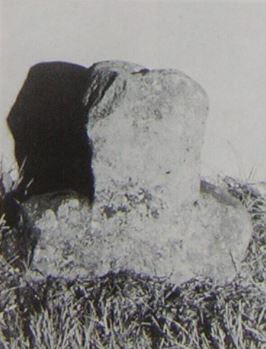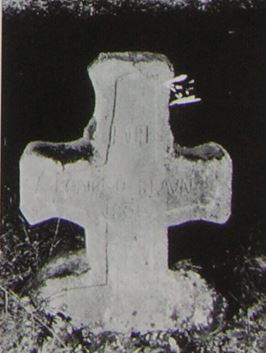|
Ang. B. Losch, 1981: 'Standort: TK 7620 Jungingen, R 10740 H 58200, Flst. 416. An Südwand (II) und Westwand (III) der Marienkapelle, am Ortsausgang nach Salmendingen. Beschreibung: Sandstein. (II) hat auf dem Kopf drei runde Vertiefungen, (III) auf dem Kopf eine große runde Vertiefung; die Arme sind verkürzt, das Kopfende beschädigt; der Schaft steckt bis zum Querbalken im Boden. Maße: (II) Höhe 0,60 m, Br. 0,68, T. 0,17, (III) Höhe 0,50 m, Br. 0,50, T. 0,19, Form: (II) Tatzenkreuz, leicht asymmetrisch. - (III) leicht geschwungene Kopfverbreiterung, hoher Kopf. Datierung: (II) ca. 15. Jh. (III) ca. 14./15. Jh. Eines der Kreuze ist vermutlich das Sühnekreuz aus dem obengenannten Totschlags-Sühnevertrag (s. Übersicht). Volkstümliche Überlieferung: 'Der Volksmund deutet sie verschieden, bringt sie mit Zweikämpfen und Totschlag in Verbindung' (Karl Theodor Zingeler-Wilhelm Friedrich Laur, Die Bau- und Kunstdenkmäler in den Hohenzollerischen Landen, Stuttgart 1896, S. 23). Die Kreuze sollen aus alten Kriegszeiten stammen' (Textkopie B. Losch 1981)
Übersicht: Die Totschlagsagen weisen auf die Herkunft der älteren Kreuze aus dem Recht der Totschlagsühne hin. Auch im Zollernalbkreis belegt ein erhaltener Sühnevertrag den Rechtsbrauch der Totschlagsühne: In Melchingen (Gemeine Burladingen) wurde um 1450 Hans Singer aus Undingen von Hans Nollhart und Hans Boltz im Streit erschalgen. Die Grafen Jos Niklas zu Zollern (Hauptmann der Herrschaft Hohenberg), Eberhard von Württemberg (Herr von Undingen) und Georg von Werdenberg (Besitzer von Melchingen) setzten folgenden Vergleich zwischen den Tätern und den Hinterbliebenen fest: (1) Die Täter mußten 40 Messen lesen lassen und mit 60 Männern, jeder mit brennenden halbpfündigen Wachskerzen, die Täter mit Kerzen von je einem Pfund, zum Opfer gehen (2) Sie mußten ein fünf Fuß hohes und drei Fuß breites Steinkreuz aufrichten lassen; (3) einen Jahrtag für Hans Singer stiften; (4) an die Hinterbliebenen 20 Gulden Entschädigung zahlen; (5) binnen Jahresfrist je eine Wallfahrt nach Aachen und Einsiedel ausführen. Durch diesen Vertrag wurden die Parteien versöhnt und die Täter entgingen einer Leib- oder Lebensstrafe. Vermutlich handelt es sich bei einem der erhaltenen Kreuze um das vereinbarte Sühnekreuz. Auf einen weiteren Sühnevertrag von 1610 nimmt eine Melchinger Urkunde von 1614 Bezug. Hans Jacob Hoch hatte Andreas Goggel von Trochtelfingen (Landkreis Reutlingen) umgebracht. Im Sühnevertrag war u. a. vereinbart, daß der Täter sich 20 Jahre lang im Verteidigungsdienst an den östlichen Reichsgrenzen aufhalten solle. Da er aber keine Anstellung fand und zurückgekehrt war, wurde 1614 eine Abmachung getroffen, wonach der Täter außerhalb der Herrschaft Trochtelfingen wohne und den Hinterbliebenen aus dem Weg gehen mußte. Für die Einhaltung der sonstigen Sühnevertragspflichten von 1610 bestellte er seinen Bruder zum Bürgen, ferner verpflichtete er sich zur Zahlung von 30 Gulden Unkosten an die Hinterbliebenen und 100 Gulden an die Kirche in Melchingen. (K. Th. Zingeler-Georg Buck, Zollersche Schlösser, Burgen und Burgruinen in Schwaben, Berlin 1906, S. 118/Karl Dreher, Der Burichinga-Gau, Tübingen 1957, S. 57/Anton Birlinger, Aus Schwaben - Sagen, Geschichten, Rechtsbräuche, Wiesbaden 1874, S. 473-475)' (Textkopie B. Losch 1981)
|